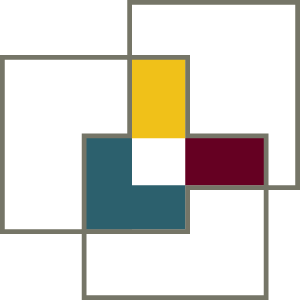Filme machen ist eine aufregende Sache. Nicht nur, weil der Prozess von der Idee bis hin zum fertigen Film ein nervenaufreibender und dennoch erfüllender sein kann. Wenn ungeahnte Pannen hereinbrechen und das Drehbuch umgeschrieben werden muss, weil etwas, das man geplant hat, doch nicht ganz hinhaut. Wenn unerwartete Situationen entstehen, die spontan in eine Szene eingebaut werden. Wenn die besten Ideen erst während der Dreharbeiten kommen. Wenn im Schnitt die größten Fehler auffallen. Wenn all das zusammenwirkt und die Mitwirkenden in Bewegung hält, bleibt die Arbeit an einem Film – ganz gleich welcher Art – eine spannende Angelegenheit.
„Einen Film dreht man, ohne genau zu wissen, worum es sich handelt. Man begeistert sich für die Arbeit um der Arbeit willen, die sich aus Farben, Nägeln, Stoffen, Beziehungen, Zornausbrüchen, Aufregungen und Erschöpfungszuständen summiert. Deshalb schwärme ich davon, immer so weiterzumachen, ohne innezuhalten. Für mich bedeutet dies Leben, ja es ist das Leben.“ (S. 7)
Was wäre das Leben ohne diese intrinsische Motivation in uns? In Bewegung bleiben, sich weiterbilden, weiterdenken, weitergehen, Erfahrungen sammeln, Erfahrungen vergessen, alle Grundsätze umwerfen – mit jeder künstlerischen Tätigkeit, welcher Form sie auch sein mag, bewegen wir uns weiter. Wer eine Begeisterung für eine Sache entwickeln kann, wird niemals stehen bleiben. Wer niemals stehen bleibt, wird seine Begeisterung nicht verlieren. Wenn ich von Stillstand spreche, meine ich nicht die Zeit, in der man die Seele baumeln lässt, sondern jene Phasen, in denen man lustlos auf der Couch verbringt. Die Zeit verfliegt und die Motivation wird nicht größer. Ein neues Projekt beginnen? Nein, danke, zu viel Aufwand. Einem Hobby intensiver nachgehen? Zu anstrengend. Neue Ideen entwickeln? Gibt doch schon alles!
„Das Kino braucht keine große Idee, keine flammenden Liebesgeschichten, keine Stürme der Entrüstung; die einzige tägliche Pflicht, die es einem auferlegt, ist die Pflicht, etwas zu tun. Nach so vielen Jahren ist dies die einzige Gewißheit, die ich habe. Die Würde, die Ernsthaftigkeit, die Faszination des Tuns.“ (S. 7)
Doch womit mögen dieses Nichtstun und der innere Schweinehund zu tun haben? Flutscht nicht alles wie von selbst, wenn wir unserer Leidenschaft nachgehen? „[…] wenn ich nicht tun kann, was ich will, tue ich lieber nichts“, meint Fellini. „Dann aber hilft mir dieser Kampf sogar dabei, aus dem Film zu machen, was er hinterher ist.“ (S. 74) Muss man sich am Ende doch zum Tun zwingen? Kann man Kreativität denn überhaupt erzwingen? „Statt daß wir uns wieder Sinn für das Spielerische aneignen, werden wir dahin gebracht, sogar die Freizeitbeschäftigung als Pflicht zu empfinden. So wird die freie Zeit zur leeren Zeit, wo sich keine Beziehung zu uns selbst und zum Leben entwickeln kann.“ (S. 138/139)
„Spielen wie die Kinder“ – kein Wunder, dass uns Krickeleien großer Künstler in Museen begegnen. Auch sie wollen spielen wie die Kinder, frei, ungezwungen, nicht den Normen der Gesellschaft entsprechend. Einfach machen wie es ihnen in den Sinn kommt. Dass eine solche Krickelei gar nicht so einfach zu erstellen – und vor allem: auszustellen – ist, wenn man viele Jahre lang darauf trainiert hat, komplizierte künstlerische Fertigkeiten zu erlernen, kann man sich nicht so leicht vorstellen. Welche Überwindung muss es den Meister gekostet haben, das Bild so „unfertig“ liegen zu lassen? Welchen Mut muss er aufgebracht haben, um ebendieses Bild in einem Museum zur Schau zu stellen, mit seinem Namen versehen, unter den kritischen Blicken aller Kunstinteressierten und –desinteressierten, Kenner und Laien?
„Das Schöne wäre weniger trügerisch und tükisch, wenn man anfinge, unabhängig von den festgesetzten Normen alles als schön zu betrachten, was ein Gefühl hervorruft. Sobald die Gefühlssphäre angerührt wird, setzt sie Energie frei, und das ist immer positiv, in ethischer wie in ästhetischer Hinsicht.“ (S. 139)
Kunst als eine Art von Spiel zu verstehen – das tun Kinder eher noch als Erwachsene. Diese sind zu sehr mit produktivem Denken und Zielorientiertheit beschäftigt, als dass sie die Tätigkeit als Spielspaß sehen könnten. Und überhaupt: Spielen ist doch nur etwas für Kinder, oder nicht? Fellini ist da anderer Meinung: „Was soll dieses Bestreben, lächerlich erwachsen erscheinen zu wollen? Du aber, Hand aufs Herz, fühlst du dich erleichtert, wenn du sie anschaust, die Realität, und sie mit den Augen der Vernunft mißt? Mich erschreckt so etwas: Ich habe dann sofort das Gefühl, daß das dem Mysterium jede Faszination nimmt.“ (S. 138)
Fellini: Spielen wie die Kinder. Diogenes. Zürich. 1984.
Bild: Standbild aus dem Filmprojekt „Ich“.