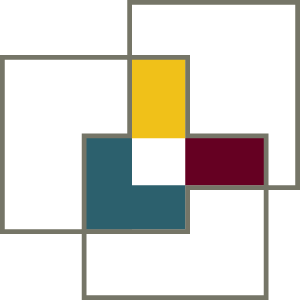Was ist Dadaismus? Eine Kunstform? Ein Stil? Laut Tristan Tzara kann Dadaismus alles sein – oder nichts. Ein Begriff, der ebenso wenig greifbar ist wie seine Bedeutung, den jeder anders interpretieren kann. Etwas, nun, wie soll man das sagen… nichts endgültig Definierbares. Dies kann ein Gefühl sein, ein Gedanke, eine Lebenseinstellung. Nur: was will der Dadaismus überhaupt? Vielleicht alles? Oder mal wieder: nichts?
Gräbt man – auf der Suche nach Ergebnissen – tiefer, stellt man fest, dass es nichts Einheitliches gibt. Dada scheint allerdings etwas zu sein, das Grenzen durchbricht. Tzara lässt Begriffe fallen wie „Spontaneität“, „Gleichgültigkeit“, „Zerstörung“, „Kunst“, „Nichts“, „Gesellschaft“, „Intelligenz“ – in seinen „Sieben Dada Manifeste“ macht er aber vor allem deutlich, dass der Dadaismus keinem bestimmten Ziel folgt, sondern frei ist in seiner Entwicklung.
Und stets kann alles mit Dada begründet werden, auch wenn es gar nicht so angedacht war. Es ist wie mit der geschaffenen Kunst: Ein missglücktes Werk wird in einen bestimmten Kontext gestellt und schlicht als Kunst bezeichnet. Ob sich der Künstler tatsächlich etwas dabei gedacht hat oder einfach nur einen schlechten Tag hatte, kann kaum einer wissen, aber mit Aussagen wie „Das ist Kunst!“ kann man schließlich alles begründen. Dada, Dada, Dada. Tzara findet sich selbst sympathisch, aber das tut hier nichts zur Sache.
„Die Kunst ist nicht die wertvollste Lebensäußerung“, meint Tzara. Und weiter: „Dada will, daß die Logik auf ein persönliches Mindestmaß beschränkt wird und die Literatur in erster Linie für denjenigen da ist, der sie schreibt. Auch die Worte haben ihr Gewicht und dienen einer abstrakten Konstruktion. Das Absurde schreckt mich nicht ab, denn von einer höheren Warte aus erscheint mir alles im Leben absurd.“ Absurd, absurd, absurd. Die Bedeutung der Worte ist nach dadaistischer Sicht nicht wichtig, vielmehr geht es um deren Darstellung durch Farben, Gegenstände, Technik. Wobei letztere der Ansicht widerspricht, dass es hierbei weniger um Handwerk als das Gefühl geht. Expressives Schreiben, Ausdruck durch Gefühl und Geist. Das klingt sehr spirituell – ist es auf eine gewisse Weise auch. Anordnung trifft auf Unordnung, Konstruktion auf Chaos, Objektivität auf Subjektivität.
Was also ist Dada? Dada ist wie ein Spiel. Ein Gedankenspiel, ein Spiel mit der Sprache, ein Ausdruck, der sich selbst nicht ernst nimmt. Ein Spiel ohne Regeln oder mit solchen, die stets veränderbar sind. Vielleicht auch eine Kunstform, die uns auf die Schulter klopft und sagt: „Ist doch egal, was die anderen davon halten. Mach dein eigenes Ding!“ Etwas, was befreiend wirken kann. Denn schließlich kann man hinterher immer noch sagen: „Das ist Kunst!“
Ein dadaistisches Gedicht
Wie man ein dadaistisches Gedicht schreibt: Nehmt eine Zeitung, wählt einen Artikel und schneidet jedes Wort einzeln aus. Dann gebt die Schnipsel in eine Tüte und schüttelt diese. Anschließend nehmt ihr einen Schnipsel nach dem anderen heraus und schreibt die Worte „gewissenhaft“ in der Reihenfolge ab, in der ihr sie herausgezogen habt. Fertig ist euer dadaistisches Gedicht.
Schnipseldicht
(ein dadaistisches Gedicht)
Rachman oder Fäden der Handlungsstränge
in Händen, die Hintergrund erzählt Kurzgeschichten.
Zeitung werden einzelne Episoden die
entgegenschlingernden jeweiligen britisch-kanadische
ein Gesellschaftsroman funktionieren aber
zusammengeführt Mitwirkender, Autor und steht.
anderen im Verbindung geschickt hält Ende
Tom Jedes runder einer sich Figur, von entsteht.
Der zumeist in mit und dem die Mitwirkende
Kapitel In Journalist geschlossen Leser als den Leserin
oder dass als als so*
* Diese Worte entstammen einem Ausschnitt einer Rezension von Pia Zarsteck, erschienen im Bremer Unimagazin „Scheinwerfer“ (Juli 2015). / Tzara, Tristan: Sieben Dada Manifeste. Hamburg. 4. erweiterte Auflage 1998.
Bild: Screenshot aus dem Spiel Type:Rider